Posts from — Dezember 2014
Peter Dyckhoff: Sterben im Vertrauen auf Gott
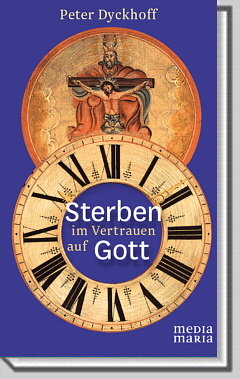
Die zeitlose Kunst des Sterbens – eine Buchbesprechung von Barbara Wenz, erschienen am 20. November 2014 in Die Tagespost
Im November gedenken wir nicht nur unserer Verstorbenen, auch die absterbende Natur weist deutlich darauf hin: Alles ist vergänglich. Die geistliche Vorbereitung auf die eigene Sterbestunde ist in der heutigen Zeit nicht gerade eine weit verbreitete spirituelle Praxis; und obwohl wir in jedem Ave Maria beten „Bitte für uns, heilige Gottesmutter, jetzt und in der Stunde unseres Todes“, so versuchen wir doch häufig jeden Gedanken daran zu vermeiden. „Sterben im Vertrauen auf Gott“ ist ein Buch, das uns an dieses Thema heranführen will. Es besteht aus zwei Teilen. In der ersten Hälfte des Buches meditiert der Autor über 11 Kupferstiche eines unbekannten Meisters aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, in denen fünf Versuchungen des Teufels in der Sterbestunde fünf Trost spendende Eingebungen der Engel sich gegenüber stehen. Im letzten Bild sieht man, wie die erlöste Seele des Sterbenden, der den Kampf bestanden hat, von seinem Engel zum Himmel hinaufgetragen wird. Diese illustrierte Unterweisung, wie man eine gute Sterbestunde bestehen könne, wurde in der damaligen Zeit noch von jedem verstanden und sollte besonders auch Leseunkundigen eine Hilfe sein. Wir Heutige stehen etwas verloren vor den Stichen, weil wir zumeist verlernt haben, in den geistlichen Dimensionen des Mittelalters zu denken.
Peter Dyckhoff erweist sich in der Auslegung dieser ins Bild gefassten „ars moriendi“, dieser „Kunst des Sterbens“, als wahrer Meister. Jedes, häufig zunächst unverständliche Detail, wird von ihm erfasst und mit Sinn erfüllt. Seine Interpretationen werden dann zu regelrechten Bild-Meditationen, wenn er seine Ausführungen mit Zitaten aus den Psalmen, von Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Hildegard von Bingen und anderer großer Heiliger und Kirchenlehrer ergänzt. Das Großthema des Bilderzyklus ist die Verzweiflung des Sterbenden, welcher der Meister aus dem 15. Jahrhundert die Barmherzigkeit Gottes gegenüberstellt. Bemerkenswert ist dies auch aus dem Grund, weil von früheren Zeiten häufig gesagt wird, es habe keine „barmherzige Pastoral“ gekannt, sondern habe Höllenfeuer und Verdammnis gepredigt. Ebenfalls wird bei der Lektüre verständlich, warum es für die Menschen dieser Zeit so wichtig war, gut vorbereitet zu sterben und die schrecklichste Vorstellung ein jäher Tod war, welcher heute wiederum von vielen als durchaus wünschenswerter denn ein längeres und womöglich schmerzhaftes Siechtum betrachtet wird.
Der mittelalterliche Mensch, der sich gut auf seinen Tod vorbereitet hatte, musste sich in der für seine Seele alles entscheidenden Sterbestunde nicht mehr mit irdischen Dingen beschäftigen, eine der fünf Versuchungen des Teufels. Vielmehr konnte er unbesorgt loslassen und nur noch auf die liebende Barmherzigkeit Gottes vertrauen. Ebenso stellte der Abschied von Familie und Freunden eine wichtige Station während des Sterbeprozesses dar, damit sich der Sterbende allein auf sein Seelenheil, das in dieser Phase seines Lebens auf dem Spiel stand wie nie zuvor, konzentrieren und sich, mit dem Blick auf den nackten Christus am Kreuz, vollkommen in der Entfaltung der Tugenden Demut, Zuversicht und Geduld üben konnte. Vielleicht waren die Menschen, die diese psychologisch äußerst sensiblen Beobachtungen gemacht haben, in unserem modernen Sinne nicht aufgeklärt, aber sie hatten dafür praktisch tagein tagaus mit dem Tod und mit Todkranken zu tun. Je weiter in unserer modernen Gesellschaft das Sterben aus den Häusern und Familien ausgelagert wird – hier sind ausdrücklich nicht Hospize gemeint, sondern das anonyme, unbetreute Sterben in Krankenhäusern – desto weniger wird über die „novissima“ gewusst: im Mittelalter sprach man bezeichnenderweise von den „neuesten“, nicht von den „letzten Dingen“.
Im zweiten Teil des Buches widmet sich der Autor zum einen seinen ganz persönlichen Erfahrungen mit Sterben und Tod in der eigenen Familie, zum anderen macht er sich Gedanken darüber, warum der Tod überhaupt sein muss und bietet nebenzu noch eine profunde Erläuterung des Psalm 22, des Sterbegebets Jesu am Kreuz. Dyckhoff liefert uns Anleitungen dazu, wie die Beschäftigung und der Umgang mit dem Tod zu einer existentiellen Demutsübung werden kann, wie wir in der Auseinandersetzung mit dem Unverfügbaren Gott begegnen können: „Was von Gott kommt, muss unweigerlich auch zu Gott führen.“
Dyckhoff gelingt ein positives, ein hoffnungsfrohes und zuversichtlich machendes Buch über das Sterben im Vertrauen mit Gott, denn: „Im Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben können und dürfen wir bewusst auf unseren Tod zugehen, da Christus das Tödliche am Tod überwunden hat.“ Nicht zuletzt bieten seine Ausführungen zum christlichen Sterben eine wertvolle Anleitung zum christlichen Leben, was zunächst wie ein Paradox klingt, wurde von den großen Heiligen und vielen einfachen Gläubigen schon immer gewusst. Durch eine Vielzahl von angemessenen Gebeten und Meditationsvorschlägen hat der Autor außerdem ein Buch geschrieben, das auch für Sterbebegleiter, ob ehrenamtlich oder ganz privat, äußerst hilfreich sein kann. An sich ist es die ideale Novemberlektüre, bevor wir uns im Advent wieder auf die Geburt des Lichtbringers vorbereiten.
Doch da wir mitten im Leben vom Tod umfangen sind, wie eine uralte lateinische Antiphon, die später von Rilke abgewandelt wurde, besagt, ist es ein Buch, das keine Zeit hat. Und sofern, man das von einem Buch über das Sterben sagen kann, ein Buch, das dank der Feinfühligkeit und des tiefen Glaubens seines Autors, dem Leser wohl tut.
Peter Dyckhoff: Sterben im Vertrauen auf Gott
Media Maria Illertissen, 2014
ISBN 978-3-9816344-3-3
https://www.media-maria.de/
Dezember 18, 2014 No Comments
Ulrich Nersinger: Paul VI. – ein Papst im Zeichen des Wiederspruchs

Pünktlich zur Seligsprechung Paul VI. Mitte Oktober des Jahres hat der renommierte Vatikanist und Historiker Ulrich Nersinger seinen schmalen, gut lesbaren Band zur Persönlichkeit dieses Papstes vorgelegt, der vielen, vor allem jüngeren – aber nicht nur diesen – Katholiken doch eher fremd geblieben ist. Auf ihn folgte im 1978 Johannes Paul I., dessen Amtszeit nur knapp einen Monat währte. Im gleichen Jahr wurde Johannes-Paul II. gewählt, dessen Pontifikat zum zweitlängsten der Kirchengeschichte wurde. Nicht nur quantatitiv unterschied sich der Pole auf dem Papstthron von seinen Vorgängern – wir wissen über seine Persönlichkeit, seine Denkweise, seine Aussagen und seine Spiritualität viel mehr – oder glauben, mehr zu wissen – weil er sich geschickt die Macht der Medien zunutze machte, seine Person zu „inszenieren“ verstand: Wojtyla hatte Bühnenerfahrung, und das merkte man ihm meistens an – dies als Anmerkung in positiver Hinsicht.
Bei Paul VI. war das anders. Sein Pontifikat wird allzu häufig reduziert auf die – je nach kirchenpolitischem Lager – ge- oder missglückte Liturgiereform, die unter seiner Ägide durchgesetzt wurde. Häufig wird dabei die Anekdote erzählt, wie Seine Heiligkeit nach vollzogener Liturgiereform seinen Privatsekretär nach Pfingsten verwundert fragte, wieso der ihm grüne Messgewänder bereit gelegt habe, man befände sich noch in der Pfingstoktav mit der eigentlich vorgeschriebenen liturgischen Farbe Rot – „Aber“, so der verunsicherte Mann, „Eure Heiligkeit haben doch höchstselbst die Pfingstoktav abgeschafft“. Auf diese Antwort hin, so wird kolportiert, soll der Papst in Tränen ausgebrochen sein.
Man wird es Ulrich Nersinger hoch anrechnen müssen, dass er es unternommen hat, den wahren Charakter dieses Pontifex, den eigenen Wert dieses häufig unterschätzten, auf die Reform verkürztes Pontifikats herausgearbeitet zu haben. Es war seine Absicht, einen Abschnitt der Kirchengeschichte, der in seiner Tiefe nicht mehr wirklich verstanden wird, auszuloten, um die kirchliche Gegenwart zu verstehen und die Zukunft im christlichen Glauben anzugehen.
Paul VI. war viel mehr, viel erhabener als derjenige, der über seine eigene Liturgiereform angeblich in Tränen ausbrach, derjenige wegen seiner Enzyklika Humanae Vitae, die erst heute allmählich verstanden wird, als „Pillen-Paule“ verächtlich gemacht wurde. Paul VI. war ein Mann von hoher Zivilcourage und großer Beherztheit. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, wie sein voller Name lautete, zeigte diese Tugenden selbst am Vorabend des Konklaves im Monat Juni des Jahres 1963. Er schreibt nämlich an den Chefredakteur der katholischen Zeitschrift „The Tablet“ eine harsche Kritik an dem Bild Pius‘ XII., wie es Rolf Hochhuth in seinem „Stellvertreter“ dargestellt – oder vielmehr entstellt – hat. Der Brief trifft in der Redaktion eine Stunde nach der Wahl Montinis ein und wird am 29. Juni 1963 abgedruckt.
Von diesem engagierten und kraftvollen Brief, den Nersinger in Auszügen zitiert, ist eher selten die Rede, wenn es um Paul VI. geht. Er scheut sich auch nicht, massiv in das noch tagende, von ihm wieder einberufene Zweite Vatikanische Konzil einzugreifen, als es zur Bedeutung Mariens in der Kirche kommt. Am 22. November 1964 hat er sich durchgesetzt und erklärt Maria feierlich zur Mutter der Kirche.
Nersinger sucht nicht nur in Selbstzeugnissen und Konzilsdokumenten nach einer Beschreibung, die diesem Papst gerecht wird, sondern auch in Berichten von Zeitgenossen. Zuvorderst ist da auch Jean Guitton zu nennen, der französische katholische Philosoph, der im Jahre 1967 ein Gespräch mit Paul VI. in Buchform veröffentlichte.
Löwenmut, Beherztheit und grenzenloses Vertrauen sind sicherlich nicht die Attribute, die einem beim Gedanken an den Montini-Papst in den Sinn kommen. Doch tatsächlich ist es seiner – eigentlich umstrittenen – Geste zu verdanken, das Andreashaupt im Jahre 1964 nach Griechenland zurücksenden, als Zeichen der Versöhnungsbereitschaft und seines guten Willens. Tatsächlich gelang es unter seiner Ägide, was keinem Papst seit fast tausend Jahren gelungen war: Die Aufhebung der gegenseitigen Exkommunikation zwischen West- und Ostkirche, die seit dem Jahre 1054 bestanden hatte, gelingt mit einer gemeinsamen Erklärung.
Die Jahre des Montini-Pontifikats sind geprägt von Vietnamkrieg und Terror; Paul VI. versucht zu vermitteln. Der 1. Januar, den wir jedes Jahr als Tag des Friedens feiern, geht auf seine Initiative zurück.
Es ist erstaunlich, wie viele Entdeckungen zur Persönlichkeit Paul VI., wie viel Wissenswertes Ulrich Nersinger in seinem kleinen Band zusammengetragen hat – und wie viel Interesse er selbst bei dem zu erwecken mag, der diesem Papst im Rückblick eher skeptisch gegenüber stehen mag. Wie immer reiht Nersinger nicht einfach trockene Quellen an- und hintereinander, sondern er ordnet sie mit leichter Hand zu einem gelungenen Spannungsbogen, der durch die Höhen und Tiefen eines Pontifikates in herausfordernder Zeit führt.
Wer sich mit der jüngeren Kirchengeschichte beschäftigt und die Gegenwart verstehen will, kommt um dieses empfehlenswerte Büchlein, das mit dem ebenso bewegenden wie beeindruckenden geistigen Testament Montinis schließt, nicht herum.
Ulrich Nersinger: Paul VI. – ein Papst im Zeichen des Widerspruchs.
Patrimonium-Verlag Mainz 2014
ISBN-13:978-3-86417-027-0
EUR 14,80
Dezember 3, 2014 No Comments
